News.
Der Tod sind wir
Die Filmstarts der Woche
Nominiert für 9 Deutsche Filmpreise: Matthias Glasners „Sterben“ mit Lars Eidinger und Corinna Harfouch marschiert furchtlos auf die essentiellen Themen des Lebens zu.
Meister des Sensenhumors
Cartoonist Michael Holtschulte präsentiert seine Werke bei kunstwerden in Essen
Michael Holtschulte stellt seine Cartoon-Kunst in den Räumen des Vereins kunstwerden im Essener Süden aus und erscheint dort auch persönlich zu besonderen Events.
Die mit dem Brokkoli kuschelt
Mina Richman in Recklinghausen – Musik 04/24
Zwischen musikalischen Genres, spielfreudig und in außergewöhnlich intimer Atmosphäre zeigte sich die Musikerin mit ihrer Band in der Altstadtschmiede.
Auf Tuchfühlung
Indie-Rocker LEAP in Dortmund – Musik 04/24
Die junge Band zeigte sich im Junkyard ganz nah am Publikum. Musik und Performance bestätigen die großen Erwartungen, die mit den Musikern um Jack Balfour Scott verbunden werden.
Utopie und Verwüstung
„The Paradise Machine“ in Dortmund – Ruhrkunst 04/24
Der HMKV zeigt acht Film- und Fotoinstallationen von Niklas Goldbach, der bis zum 11. August in die ganz spezielle Welt der künstlich angelegten Ferienparadiese entführt.
„Die Realitäten haben sich verändert“
Die Kuratorinnen Özlem Arslan und Eva Busch über die Ausstellung zur Kemnade International in Bochum – Sammlung 04/24
1974 rief das Kunstmuseum Bochum das Festival Kemnade International ins Leben, um die Verständigung und die Sichtbarkeit der verschiedenen Gruppen von Zugewanderten im Ruhrgebiet zu fördern. Die Ausstellung ist ab 27. April zu sehen.
Wiederentdeckt
Werke von Amerikas erster schwarzer Klassikerin in Essen – Klassik an der Ruhr 04/24
Das Rotterdam Philharmonic Orchestra präsentiert zwei Violinwerke von Florence Price, der ersten schwarzen Pionierin einer genuin amerikanischen klassischen Musik. Am 30. April zu hören.
Die Seele geraubt
„Hello Dolly“ am Gelsenkirchener MiR – Musical in NRW 04/24
Trotz fulminanter Musik ist das größte Manko der Inszenierung unübersehbar: Dem renommierten Choreographen Paul Kribbe gesteht man nur ein zwölffüßiges Tanzensemble zu. „Hello Dolly“ ist noch bis zum 7. Juli zu sehen.
„Ich wollte die Geschichte dieser Mädchen unbedingt erzählen“
Karin de Miguel Wessendorf über „Kicken wie ein Mädchen“ – Portrait 04/24
Karin de Miguel Wessendorf arbeitet an einer sechsteiligen Doku-Serie über Mädchen, die Profifußballerinnen werden möchten.
Tödlicher Sturm im Wurmloch
„Adas Raum“ am Theater Dortmund – Prolog 04/24
Der gleichnamige Roman von Sharon Dodua Otoo ist eine Zeitreise durch die Geschichte des Patriarchats und der Frauenfeindlichkeit. Am 27. April kommt er erstmals auf die Bühne.
Seite 1 von 436

Die mit dem Brokkoli kuschelt
Mina Richman in Recklinghausen – Musik 04/24
Auf Tuchfühlung
Indie-Rocker LEAP in Dortmund – Musik 04/24
Utopie und Verwüstung
„The Paradise Machine“ in Dortmund – Ruhrkunst 04/24
„Die Realitäten haben sich verändert“
Die Kuratorinnen Özlem Arslan und Eva Busch über die Ausstellung zur Kemnade International in Bochum – Sammlung 04/24
Wiederentdeckt
Werke von Amerikas erster schwarzer Klassikerin in Essen – Klassik an der Ruhr 04/24
Die Seele geraubt
„Hello Dolly“ am Gelsenkirchener MiR – Musical in NRW 04/24
„Ich wollte die Geschichte dieser Mädchen unbedingt erzählen“
Karin de Miguel Wessendorf über „Kicken wie ein Mädchen“ – Portrait 04/24
Tödlicher Sturm im Wurmloch
„Adas Raum“ am Theater Dortmund – Prolog 04/24
Das Unsichtbare sichtbar machen
Choreographin Yoshie Shibahara ahnt das Ende nahen – Tanz in NRW 04/24
Vorläufige Utopien
Danny Dziuk & Verbündete im Dortmunder Subrosa – Musik 04/24
„Mehr Freude und mehr Liebe, was anderes hilft nicht“
Musikerin Dota über die Dichterin Mascha Kaléko und den Rechtsruck in der Gesellschaft – Interview 04/24
Außerhalb der Volksgemeinschaft
Vortrag über die Verfolgung homosexueller Männer in der NS-Zeit in Dortmund – Spezial 04/24
Lauter träumen, leiser spielen
Rotem Sivan Trio im Dortmunder Domicil – Musik 04/24
Grenzen überwinden
„Frieda, Nikki und die Grenzkuh“ von Uticha Marmon – Vorlesung 04/24
Orchester der Stardirigenten
London Symphony Orchestra in Köln und Düsseldorf – Klassik am Rhein 04/24
Ins Blaue
„Planet Ozean“ im Gasometer Oberhausen – Ruhrkunst 04/24
Glaube und Wissenschaft
Louisa Clement im Kunstmuseum Bonn – Kunst in NRW 04/24
„Ruhrgebietsstory, die nicht von Zechen handelt“
Lisa Roy über ihren Debütroman und das soziale Gefälle in der Region – Über Tage 04/24
Mackie im Rap-Gewand
„MC Messer“ am Theater Oberhausen – Tanz an der Ruhr 04/24
Weltweit für Menschenrechte
Teil 1: Lokale Initiativen – Amnesty International in Bochum
Sichtbarkeit vor und hinter der Leinwand
Das IFFF fordert Gleichberechtigung in der Filmbranche – Festival 04/24
Absurde Südfrucht-Fabel
„Die Liebe zu den drei Orangen“ an der Oper Bonn – Oper in NRW 04/24
Von Minenfeldern in die Ruhrwiesen
Anja Liedtke wendet sich dem Nature Writing zu – Literaturporträt 04/24
Besuch von der Insel
„Paul Heller invites Gary Husband“ im Stadtgarten – Improvisierte Musik in NRW 04/24
Im Sturm der Ignoranz
Eine Geschichte mit tödlichem Ausgang – Glosse

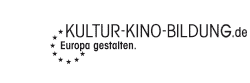




 von tr-ruhrkunst-2-678.jpg)

 von nrw-klassik-an-der-ruhr-678.jpg)


 von tr-prolog-678.jpg)