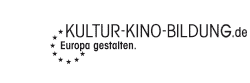„Der Fisch reagiert auf den Blinker am Haken“
Regisseur Philipp Becker über „Was glänzt“ in der Zeche Eins – Premiere 02/19
In der Bochumer Kult-Zeche Eins entsteht eine Aufführung mit Schauspiel-Studierenden der Folkwang-Universität. Philipp Becker inszeniert die Uraufführung eines neuen Stückes der österreichischen Autorin Gerhild Steinbuch.
trailer: Herr Becker, haben Uraufführungen für einen Regisseur einen besonderen Reiz?
Philipp Becker: Ja, auf jeden Fall – vor allem, wenn es ein Auftragswerk ist und ich wie in diesem Fall mit der Autorin schon mehrfach zusammenarbeiten durfte. Dieser Reiz wird nochmal potenziert, wenn man einen besonderen Ort hat. Und wird hier sogar nochmal gepitcht durch die Tatsache, dass wir eine spezielle Konstellation mit jungen Leuten haben, die sich als Ensemble seit Jahren kennen und die sich auch miteinander ausgebildet haben.

Philipp Becker studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an der Universität zu Köln und Schauspielregie an der Otto-Falckenberg-Schule, München. Er arbeitet als Regisseur und stellvertretender Leiter der Abteilung Schauspiel an der Zürcher Hochschule der Künste. Am Schauspielhaus Bochum inszeniert er in der Spielzeit 2018/19 die Uraufführung von Gerhild Steinbuchs „Was glänzt“.
Der Glanz sei das Licht der Welt, behauptet die Autorin Gerhild Steinbuch fast seriell. Ist das wirklich so oder ist das heute nicht doch eher das schnelle Gloria?
Das ist genau der springende Punkt. Etwas, das glänzt, zeichnet sich zumeist dadurch aus, dass es extrem glatt ist. Und dass die Tiefe dahinter oft überhaupt nicht erkenntlich wird. Insofern ist das eine große Faszination und eine große Gefahr, die diesen Glanz ausmachen. Ob es das Bling-Bling ist, was glänzt, oder das Geschimmer, das offenbar auch triebhaft fasziniert: Die Elster reagiert auf den Glanz, der Fisch reagiert auf den Blinker am Haken. Insofern geht es auch um die Frage, was ist die Oberfläche?
Kann der Zuschauer denn diesem Assoziationsbombardement überhaupt folgen?
Das ist die Aufgabe, die zu leisten ist. Ein dramatischer Text ist, wenn es ein guter ist, kein Lesetext, auch kein Hörspieltext, sondern dem Theater gestiftet. Ein guter dramatischer Text ist wie ein Brühwürfel. In dem steckt alles drin, was einen Liter gute Brühe ausmacht. Wenn man den Würfel so kaut, wird einem schlecht. Der braucht einen Liter Wasser und man muss das auch noch kochen. Der Text stellt also die anspruchsvolle, ambitionierte Aufgabe – aber keine unerwartete, eine sehr willkommene Aufgabe – aus diesem Assoziationsbogen spielerische Handlungen zu generieren.
Ich habe beim Lesen so eine Art Wellenbewegung im Text festgestellt – wird es auch eine Art Tanztheater in der historischen Zeche?
Also der Patina, der historischen Schicht dieses Raumes, sind wir uns sehr wohl bewusst. Es war aber auch eine bewusste Entscheidung, in diesem Fall nicht mit einem Choreografen zusammenzuarbeiten. Die Körperlichkeit wird extrem wichtig, sie wird aber nicht originär tänzerisch sein. Es wird eher etwas sehr Musikalisches. Diese Wellenbewegungen, ich würde da von einer fugischen Dramaturgie sprechen: Werden in der Musik die Motive von verschiedenen Instrumentengruppen variiert, werden diese in Gerhilds Stück von verschiedenen Figuren reflektiert und variiert.
Wie eine Art Bilder-Schnittfolge?
Es werden in diesen Assoziationsketten sehr viele Bilder verhandelt. Gerade sind wir dabei uns für den Unterschied zwischen „Bild“ und „Image“ zu sensibilisieren. Ich glaube, dass hier – auch dank der großartigen Bühnen- und Raumfantasie von Bettina Pommer – wirklich Bilder entstehen, die beredt sind. Es ist wahnsinnig herausfordernd zu zehnt gemeinsam zu denken. Wenn man dann noch überlegt, dass das Stück Themen wie kulturelle oder nationale Identität verhandelt.

Im Text steht ein Heiner-Müller-Zitat: „Wir stehen am Strand, im Rücken die Ruinen Europas“. Ist das heute nicht auch Brexit-Prosa?
Meiner Ansicht nach ja. Die Genese dieses Textvorschlags von Gerhild Steinbuch war besonders. Wir beide hatten zwar Themenfelder, aber der Raum musste zum Beispiel vor dem Stück stehen. Sowas ist natürlich super spannend. Die Autorin hat mit allen zehn Spielerinnen und Spielern gesprochen. Diese jungen Leute eint, dass sie sich selbst als Kinder der Populärkultur bezeichnen, das heißt, sie kennen oft das Rip-off vom Rip-off besser als das Original. Stichwort Heiner Müller: Ich stehe da an so einer Küste mit irgendwas im Rücken – der Kontext dieses Zitats ist schon sehr fremd. Aber – als großer Heiner-Müller-Fan darf ich das sagen – Theater ist immer aktuell, das ist eine Momentkunst, die nur im Hier und Jetzt stattfindet. Es geht also darum, sich zu verhalten. Und es gibt auch eine Tradition dieses Ortes, der Zeche Eins, der selbst mit Geschichte kontaminiert ist. Was macht es mit zehn jungen Schauspielerinnen und Schauspielern, die jetzt plötzlich hier in der Verantwortung stehen, gutes Theater zu machen? Was immer das sein soll. Wir sind gerade dabei, tagesaktuelle Stichworte, Headlines in die Assoziationsketten, die dieser Text triggert, mit einzubringen. Es geht um das Fremde, es geht um das Eigene. Es geht, wenn es um die Wölfe geht, wohl auch um die Neue Rechte. Es geht darum, ob das eine kulturelle Leistung ist, dass eine Gesellschaft sagt: „Das muss man auch mal sagen dürfen.“ Nur weil man es sagen kann, ist es vielleicht nicht immer notwendig, es auszusprechen. Und da sieht man dann die Qualität von Heiner-Müller-Sätzen, weil die zeitlos sind.
„Was glänzt“ | R: Philipp Becker | 1.(P), 2., 7.-9., 12., 14., 15.3. je 19.30 Uhr, 3., 10.3. je 17 Uhr | Zeche Eins Bochum | 0234 33 33 55 55
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

 Frohes neues Theaterjahr
Frohes neues Theaterjahr
Außergewöhnliche Januar-Premieren im Ruhrgebiet – Prolog 12/19
 Love is in the air
Love is in the air
Der Theater-März im Ruhrgebiet – Prolog 02/19
 Spaß am Tanz statt Torschlusspanik
Spaß am Tanz statt Torschlusspanik
„Pottporus“ zum letzten Mal in der Zeche 1 – Bühne 04/18
„Zu uns gehört das Lernen von den Alten“
Intendant Olaf Kröck über die Ruhrfestspiele 2024 – Premiere 04/24
„Im Gefängnis sind alle gleich“
Regisseurin Katharina Birch über „Die Fledermaus“ an den Bochumer Kammerspielen – Premiere 03/24
„Es kommt zu Mutationen zwischen den Figuren“
Intendant Ulrich Greb inszeniert „Der Diener zweier Herren“ am Schlosstheater Moers – Premiere 02/24
„Die Geschichte wurde lange totgeschwiegen“
Ebru Tartıcı Borchers inszeniert „Serenade für Nadja“ am Theater Oberhausen – Premiere 01/24
„Der Mensch braucht Freiraum, um Sinnloses machen zu dürfen“
Rafael Sanchez über „Jeeps“ am Essener Grillo-Theater – Premiere 12/23
„Ich hoffe doch, dass wir alle überleben“
Regisseurin Linda Hecker über „Totalausfall“ am Schauspielhaus Bochum – Premiere 11/23
„Bei uns klebt sich keine:r fest“
Dramaturgin Sarah Israel über das Krefelder Tanzfestival Move! – Premiere 10/23
„Dass wir vor lauter Geldfetisch nicht mehr wissen, wo oben und unten ist“
Regisseur Kieran Joel über „Das Kapital: Das Musical“ am Theater Dortmund – Premiere 09/23
„Theater wieder als Ort einzigartiger Ereignisse etablieren“
Dramaturg Sven Schlötcke übertiefgreifendeVeränderungen am Mülheimer Theater an der Ruhr – Premiere 08/23
„Die Verbindung von proletarischer Kultur und Hiphop ist ziemlich stark“
Der Künstlerische Leiter Fabian Lasarzik über Renegades „Chromeschwarz“ – Premiere 07/23
„Das Theater muss sich komplexen Themen stellen“
Haiko Pfost über das Impulse Theaterfestival 2023 – Premiere 06/23
„Was heißt eigentlich Happy End heute?“
Alexander Vaassen inszeniert „How to date a feminist“ in Bochum – Premiere 05/23
„Ich bin nicht außer mir vor Wut, im Gegenteil“
Olaf Kröck über die Recklinghäuser Ruhrfestspiele und Theater in Kriegszeiten – Premiere 04/23
„Jede Person hat zwei Rollen“
Friederike Heller über „Das Tierreich“ an den Bochumer Kammerspielen – Premiere 03/23
„Bedürfnis nach Wiedergutmachung“
Aisha Abo Mostafa über „Aus dem Nichts“ am Theater Essen – Premiere 02/23
„Der Gegenpol zum Wunsch nach Unsterblichkeit“
Ulrich Greb über „#vergissmeinnicht“ am Schlosstheater Moers – Premiere 01/23
„Geld ist genau das Problem in diesem Bereich“
Maike Bouschen über „Zwei Herren von Real Madrid“ am Theater Oberhausen – Premiere 12/22
„Es geht um eine intergenerationelle Amnesie“
Vincent Rietveld über „Bus nach Dachau“ am Schauspielhaus Bochum – Premiere 11/22
„Was ist das eigentlich, was wir Humanismus nennen?“
Kathrin Mädler bringt „Kissyface“ erstmalig auf die Bühne – Premiere 10/22
„Die Urwut ist ein Motor des Menschen“
Jessica Weisskirchen über ihre Inszenierung des „Woyzeck“ – Premiere 09/22
„Fabulieren, was möglich sein könnte“
Anne Mahlow über das Dortmunder Favoriten Festival – Premiere 08/22
„Die müssen unser Zusammenleben noch 70 Jahre lang ertragen“
Anne Britting über die Junge Triennale – Premiere 07/22